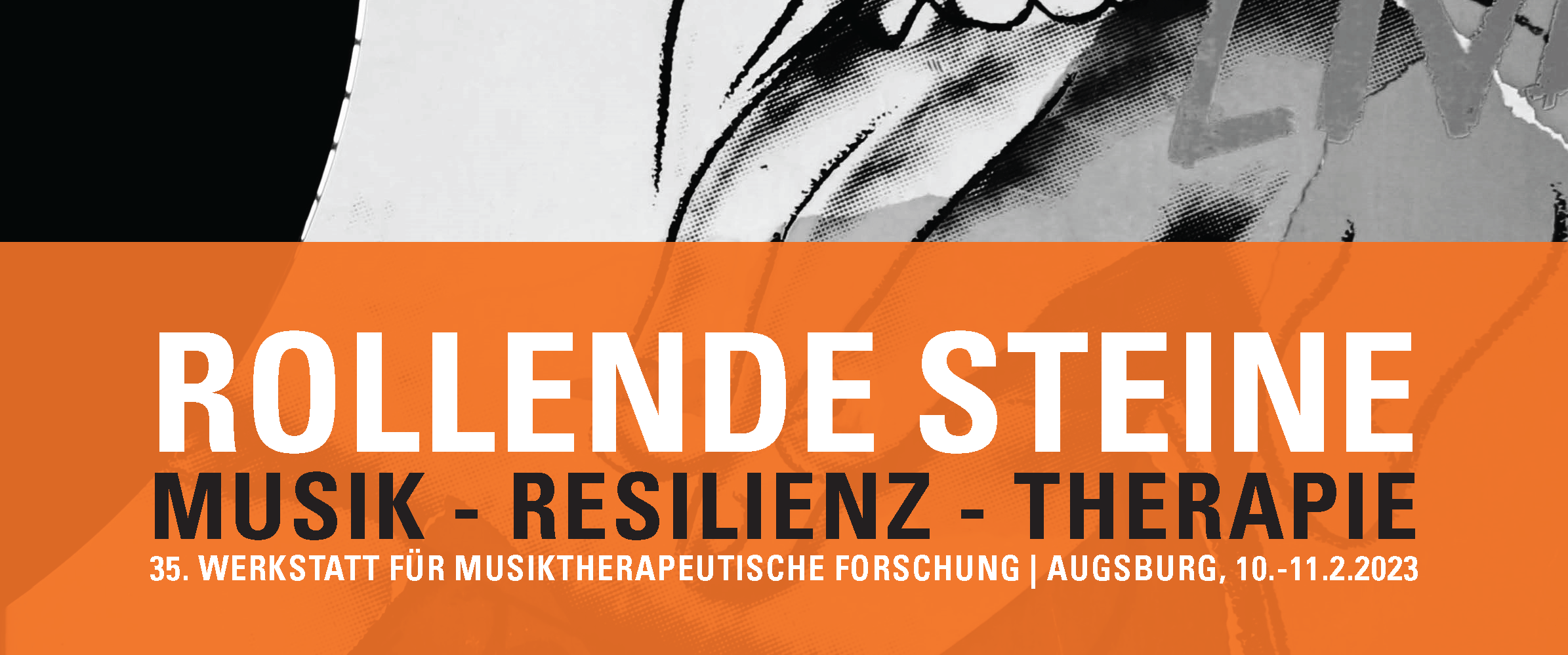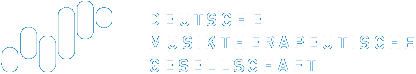Keywords
Musiktherapie, DBT, Psychische Erkrankungen, Borderline Persönlichkeitsstörung, Verhaltenstherapie

In meiner Arbeit als Musiktherapeutin mit Patient:innen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung in einem verhaltenstherapeutischen Setting erfahre ich immer wieder, wie Musiktherapie eine erlebnisorientierte Ebene hinzufügt und so das DBT-Therapiemanual bereichert.
Allgemeine Angaben
Projektleitung
Irina Simonet
Beteiligte Personen
Prof. Dr. Eckard Weymann (1. Betreuer)
PD Dr. Christian Stiglmayr (2. Betreuer)
Institution
Hochschule für Musik und Theater Hamburg
Zeitlicher Rahmen
Aktuell bis 2025
Rahmen der Arbeit
Dissertation
Form der Arbeit
Studie
Förderung
Stipendium der Andreas Tobias Kind Stiftung
Hintergrund
In der psychotherapeutischen Behandlung von psychiatrischen Patient:innen setzen sich zunehmend störungsspezifische Behandlungskonzepte durch. Die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) ist ein Konzept, das zur Behandlung von mit Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt wurde und inzwischen auch bei einer Vielzahl anderer Krankheitsbilder Anwendung findet. Das zunächst für die ambulante Therapie entwickelte Konzept wird mittlerweile auch in psychiatrischen Krankenhäusern praktiziert. Im stationären Setting kommen verschiedene Professionen und Fachtherapeut:innen, so auch Musiktherapeut:innen, immer mehr in Kontakt mit der DBT. Während für die Ergotherapie und auch die Kunsttherapie bereits Rahmenkonzepte entwickelt worden sind, ist dies für die Musiktherapie bisher nur ansatzweise vorgenommen worden. Allerdings weisen die Inhalte der DBT wie Achtsamkeit, Stresstoleranz, Emotionsregulation, zwischenmenschliche Fertigkeiten und Selbstwert und im Besonderen das DBT-Skillstraining, viele Überschneidungen mit den Inhalten der Musiktherapiepraxis, auch in non-DBT-Settings, auf. Leider mangelt es zurzeit noch an konkreten Studien und ausführlichen Konzeptualisierungen zu Musiktherapie im Rahmen der DBT.
FORSCHUNGSFRAGEN
Können innerhalb der Musiktherapie Inhalte des DBT-Skillstrainings aufgenommen und in musiktherapeutischen Interventionen umgesetzt werden?
Gibt es einen spezifischen Beitrag der Musiktherapie bei Integration in das DBT-Konzept?
Welche Möglichkeiten und Schwierigkeiten ergeben sich durch die Integration der Musiktherapie in das DBT-Konzept?
Wie kann eine Integration von Musiktherapie in das DBT-Konzept gestaltet werden?
Methode
Design: Qualitative Studie
Die Datenerhebung erfolgt in mehreren Methoden und Schritten im Sinne der Methoden Triangulation.
- Systematische Literaturrecherche zur Ermittlung des momentanen Forschungsstands zu Musiktherapie im Rahmen der DBT, sowie zu Musiktherapie bei Borderline-Persönlichkeitsstörung.
- Expert:innen-Interview mit zwei Co-Therapeut:innen, die über den Zeitraum eines Jahres an der Musiktherapie im Rahmen der DBT teilgenommen haben.
- Patient:innen-Fragebogenstudie zur Erfassung der Erfahrungen mit Musiktherapie im Rahmen der DBT nach stationärem Aufenthalt (3 Kliniken, N=23).
- Expert:innen-Gruppendiskussion mit Musiktherapeut:innen, die im Rahmen der DBT arbeiten.
Ergebnisse
In der aktuellen Studienlage zeigt sich, dass die Inhalte der DBT und im Besonderen des DBT-Skillstrainings mehrere Überschneidungen mit den Inhalten der Musiktherapiepraxis, auch in non-DBT-Settings, aufweisen. Die DBT wird als „offen“ für andere Therapien und Musiktherapie als sinnvolle zusätzliche Komponente, die die DBT durch die Handlungs- und Erlebnisorientierung vertiefen könne, beschrieben. Alle Autor:innen weisen hierbei vor allem auf Parallelen zwischen den Modulen des Skillstrainings und den Inhalten der Musiktherapie hin. Auch Studien, die sich mit Musiktherapie und Borderline-Persönlichkeitsstörung befassen, zeigen Ergebnisse die Gemeinsamkeiten zu den Inhalten des DBT-Skillstrainings aufweisen. Besonders im Bereich der Förderung des Gefühlsausdrucks, des Umgangs mit Gefühlen, sowie der Emotionsregulation kann die Musiktherapie gute Ergebnisse dokumentieren.
Diskussion
Die Ergebnisse der Literaturstudie weisen darauf hin, dass eine Integration von Musiktherapie in das DBT-Setting möglich und sinnvoll ist. Vor allem die Ergebnisse in Bezug auf die Verbesserung des Umgangs mit Gefühlen könnten auch im DBT-Rahmen genutzt werden, zumal auch hier, in aktueller Entwicklung, die Emotionsregulation stärker in den Fokus rückt. Leider ist die Anzahl an Studien und Fachartikeln zu dem Thema sehr gering, weshalb weitere Forschung benötigt wird.
Ausblick
Innerhalb der Interviews, Fragebogenstudie und der Gruppendiskussion sollen diese Ergebnisse vertieft und ausgebaut werden, um auf dieser Basis ein Konzept für Musiktherapie im Rahmen der DBT zu entwickeln und perspektivisch zu evaluieren. Damit könnte sich Musiktherapie als Baustein in einem manualisierten verhaltenstherapeutischen Behandlungskonzept etablieren.
Eigene Veröffentlichungen
Simonet, I. (2022). Musiktherapie und die dritte Welle der Verhaltenstherapie. Musiktherapeutische Umschau, 43(1), 42-51.
Falls Sie an der Veröffentlichung Ihrer Forschungsarbeit als Steckbrief Forschung interessiert sind, finden Sie alles Wichtige, inklusive Word-Vorlage, hier in den FAQs!
Wer kann einen Steckbrief einreichen?
Alle, die gerade selbst an einem Forschungsvorhaben arbeiten, oder dieses abgeschlossen haben. Das Angebot richtet sich also an Studierende der Musiktherapie (B.A., M.A. und PhD), Musiktherapeut:innen aus Praxis und Forschung und wissenschaftliche Mitarbeiter:innen.
Wo erscheinen die Steckbriefe?
Nach redaktioneller Durchsicht erscheinen die Steckbriefe auf dem Blog der DMtG. Ausgewählte Steckbriefe werden in der Rubrik Forum Forschung in der Printausgabe der Musiktherapeutischen Umschau regelmäßig veröffentlicht und sind damit als Zeitschriftenbeitrag zitierfähig.
Ist eine Veröffentlichung garantiert?
Nach der redaktionellen Bearbeitung und Freigabe durch Sie wird Ihr Steckbrief online veröffentlicht. Eine Veröffentlichung in der Printausgabe der MU ist nicht garantiert, hier erscheinen ausgewählte Steckbriefe.
Ich habe bisher keinen Forschungssteckbrief verfasst und habe auch sonst noch keine Erfahrung damit, in Fachzeitschriften zu veröffentlichen.
Sie werden bei der Finalisierung Ihres Steckbriefes redaktionell unterstützt und wir freuen uns, wenn Sie mit der Einreichung erste Schritte als Autor:in machen.
Was kommt nach Einsendung meines Forschungssteckbriefes auf mich zu?
In der Regel wird ihr Forschungssteckbrief nicht exakt so veröffentlicht, wie Sie ihn zum ersten Mal eingereicht haben. Wie bei allen Einreichungen im Bereich der Wissenschaft erhalten Sie auch hier Kommentare und Korrekturvorschläge. Verstehen Sie dies nicht als Kritik Ihres Forschungsvorhabens, sondern als Anregung, wie Sie ihr Projekt noch besser nach wissenschaftlichen Standards darstellen können.
Was habe ich davon, den Steckbrief zu erstellen?
Sie haben eine kompakte Zusammenfassung Ihrer Arbeit, auf die Sie per Online-Link verweisen können. Damit haben Sie eine Referenz, die z.B. bei der Beantragung von einem Stipendium oder Drittmitteln hilfreich sein kann. Andere Kolleg:innen und Forschungsinteressierte erfahren von Ihnen und Ihrem Projekt und es können sich inspirierende und konstruktive Kontakte ergeben. Sie haben die Darstellung Ihres Projektes strukturiert und damit einen Entwurf für ein Abstract oder ein Kongressposter. Unter Umständen haben Sie als Autor:in einen ersten Schritt in die musiktherapeutische Forschungscommunity getan, auf den weitere folgen können.
Was mache ich, wenn ich noch keine Ergebnisse habe?
Auch laufende Projekte sind sehr willkommen. Stellen Sie Hintergrund und Ihre Methodik dar, auch vorläufige Ergebnisse können berichtet werden. Auch ein Update des Steckbriefes ist jederzeit möglich.
Wie aufwändig ist das?
Die Word-Vorlage bietet eine gute Strukturierungshilfe. Wenn Sie sich über Ihre Fragestellungen, Methodik und Ergebnisse im Klaren sind, ist das schnell ausgefüllt. Wenn nicht, lassen Sie sich Zeit, um durch die Vorlage Ihr Projekt zu strukturieren.
Was passiert mit meinem Namen, Foto und meiner E-Mailadresse?
Ihre persönlichen Daten werden allein im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Steckbriefes verwendet, damit an Ihrem Projekt Interessierte mit Ihnen in Verbindung treten können. Als DMTG-Mitglied kann es empfehlenswert sein, die entsprechende IhrName@musiktherapie.de-Adresse zu nutzen. Das Antragsformular für eine IhrName@musiktherapie.de-Mailadresse finden Sie im Mitgliederbereich.
Muss ich alles ausfüllen?
Nein. Optionale Punkte sind mit Sternchen markiert. Allerdings ist für die Veröffentlichung Ihre Zustimmung erforderlich, die Sie am Ende der Vorlage geben können.
Was mache ich mit dem ausgefüllten Steckbrief?
Sie schicken Ihn an forschung.mu@musiktherapie.de, zusammen mit einem für die Veröffentlichung freigegebenen Portraitfoto sowie kurzem CV für unsere Steckbrief-Galerie.
Wir freuen uns über Ihre Einreichung und stehen gern für Rückfragen zur Verfügung!
MU-Redaktion Forum Forschung