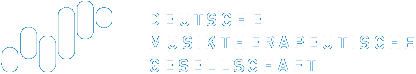Eine explorative Beobachtungsstudie
Keywords
Komplexe Behinderung, Schwerstbehinderung, nonverbal, Mixed-Methods Design, Vitalparameter

Kinder mit Komplexen Behinderungen stellen die Musiktherapeutische Praxis und Forschung vor Herausforderungen.
Ich möchte schwer kranken Kindern ein Sprachrohr in der musiktherapeutischen Forschung geben, die nicht selbst ihre Erfahrungen mitteilen können.
Allgemeine Angaben
Projektleitung
Institution
Zeitlicher Rahmen
Form der Arbeit
Rahmen der Arbeit
Gutachter:innen
Förderung
Aktuell, geplant bis 2024
Studie
Dissertation an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg
Prof. Dr. Gitta Strehlow (Erstgutachterin),
Prof Dr. Thomas Wosch (Zweitgutachter)
Stipendium der Andreas-Tobias-Kind-Stiftung, Hamburg 2021/22;
Projektförderung/Drittmittel durch Kroschke Kinderstiftung 2020/2
Projektleitung:
Monika T. Hoog Antink
Institution:
Theodorus Kinder-Tageshospiz Hamburg
Email:
monika@hoogantink.de
Zeitlicher Rahmen:
Aktuell, geplant bis 2024
Form der Arbeit:
Studie
Rahmen der Arbeit:
Dissertation an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg
Gutachter:innen:
Prof. Dr. Gitta Strehlow (Erstgutachterin),
Prof Dr. Thomas Wosch (Zweitgutachter)
Förderung:
Stipendium der Andreas-Tobias-Kind-Stiftung, Hamburg 2021/22;
Projektförderung/Drittmittel durch Kroschke Kinderstiftung 2020/2
Hintergrund
Menschen mit Komplexer Behinderung (KB) benötigen aufgrund von geistigen und körperlichen Erkrankungen und Einschränkungen in allen Lebensbereichen Unterstützung (Fornefeld, 2008). Ein Therapieauftrag der Musiktherapie kann darum die Förderung von sozio-emotionalen Fertigkeiten, zum Beispiel der Affektregulation, sein (Reimer, 2021). Die Zielgruppe dieser Studie kann sich in der Regel nicht verbal oder mithilfe anderer Symbolsprachen über ihre Erfahrungen während der Musiktherapie mitteilen. Darüber hinaus sind die Kinder selten zum Nach- oder Mitmachen in der Lage und produzieren aufgrund von starken körperlichen Beeinträchtigungen wenig musikalisches Material, welches analysiert werden könnte. Obwohl die Musiktherapie mit dieser Zielgruppe international eine lange Tradition aufweist (Hooper et al., 2008), mangelt es an Empirie über eine mögliche Wirkung von Musiktherapie. Ziel dieser Promotionsstudie ist, den Einfluss von Musiktherapie auf Kinder mit KB multiperspektivisch zu untersuchen, um so die Forschungslücke ein Stück weit zu schließen und den Kindern ein Ausdrucksmittel zu verleihen.
Forschungsfragen
- Beeinflusst Musiktherapie die Vitalparameter der Kinder mit KB im Vergleich zu einer Baseline und im Verlauf einer Therapieeinheit?
- kann Musiktherapie (als markierte Affektspiegelung) die Kinder emotional beeinflussen?
- Welche Forschungsmethoden sind hierfür geeignet?
- Was zeichnet Musiktherapie mit diesen Kindern aus?
- Zeigen sich Unterschiede zwischen Kindern, die von Geburt an behindert sind, oder die diese während ihrer Kindheit erworben haben?
- Zeigen sich Zusammenhänge zwischen Veränderungen der Vitalparameter und des Affekts?
- Was zeichnet die Musiktherapie in diesen Momenten aus?
Methode
Stichprobe der Studie sind Kinder mit KB zwischen 6 und 18 Jahren mit einem ausreichend stabilen Allgemeinzustand, die keine Symbolsprache verwenden und deren Eltern in die Teilnahme zur Studie eingewilligt haben.In dieser von der Psychotherapeutenkammer Hamburg zugelassenen Studie wird ein Mixed-Methods Design, also eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden, angewandt. Eine vorab durchgeführte, umfassende Literaturstudie im deutsch-, englisch- und niederländischsprachigen Raum bestätigte die beschriebene Forschungslücke und zeigte die Relevanz additiver Forschung für Kinder mit KB auf. Die Musiktherapieeinheiten werden per Video aufgezeichnet und hinterher schriftlich von der Musiktherapeutin dokumentiert. Darüber hinaus werden mithilfe eines Pulsoximeters und EKGs während der Musiktherapie die Vitalparameter Herzrate, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung und Puls der Kinder und Jugendlichen (6-18 Jahre) aufgezeichnet. Ziel ist es, Daten von 10 Studienteilnehmer.innen zu sammeln (N=10, jeweils 3 Musiktherapieeinheiten). Diese quantitativen Daten werden im Anschluss aufbereitet (z.B. die Herzratenvariabilität errechnet) und mit den Ergebnissen der videobasierten Mikroanalyse und Assessments und den Ergebnissen einer Qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014) der schriftlichen Dokumentation verglichen. So können, z.B. in einem Joint Display, eventuelle Zusammenhänge zwischen Veränderungen der Vitalparameter und der Musiktherapie mit dieser Zielgruppe dargestellt werden.
Ergebnisse
In der ersten Phase des Forschungsprojekts hat die Datensammlung 2021 begonnen und wurde evaluiert. Hier zeigte sich, dass aufgrund der Covidbeschränkungen, aber auch aufgrund der labilen körperlichen Zustände der Kinder, diese Sammlung wesentlich mehr Zeit in Anspruch nahm als erwartet. Das Setting und die technische Umsetzung der Datensammlung konnte in einer Pilotphase getestet und verfeinert werden.
Diskussion
Die erste Forschungsphase hat gezeigt, dass Studien über Musiktherapie mit Kindern mit KB benötigt werden und sinnvoll sind. Der Fokus auf Vitalparameter hat in den letzten Jahren in der Musiktherapie rapide zugenommen, Kinder mit KB sind davon jedoch bisher ausgeschlossen. Diese Studie kann eventuell erläutern, ob die Messung dieser Vitalparameter bei Kindern mit KB überhaupt forschungsrelevant ist. Es konnte ebenfalls bestätigt werden, dass Forschung mit dieser Zielgruppe herausfordernd und zeitintensiv ist. Kinder mit KB bilden eine statistisch kleine Zielgruppe. Die Ergebnisse der Studie werden darum nicht generalisierbar sein, könnten aber Ansatzpunkte für weiterführende oder kontrollierte Studien bieten.
Der Steckbrief Forschung von Monika Hoog Antink kann hier als pdf heruntergeladen werden.